Cicero für christliche Leser: Zur Transformation antiker Selbstsorge und Tugendethik in deutschen De officiis-Übersetzungen der Frühen Neuzeit (1450 – 1545)
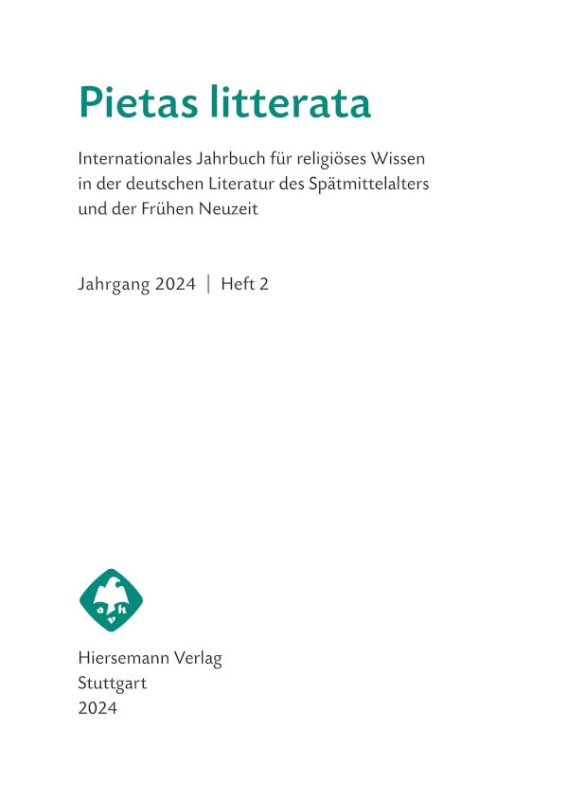
Abstract
Der Beitrag hat das Ziel, die textliche und kulturelle Aneignung von Ciceros De officiis in den deutschen Übersetzungen des 15. und 16. Jahrhunderts systematisch zu erschließen. Dabei wird die Transformation des antiken Textes sowohl im Hinblick auf die Verfahren des sprachlichen Übersetzens als auch der hand- und druckschriftlichen Präsentation analysiert. Diese doppelte Analyseperspektive ist geboten, da die Übersetzungen stark durch die erst im Medienwandel ihrer Zeit entwickelten Formen skripto- und typographischer Text-, Bild- und Wissensvermittlung geprägt sind. Um Verbreitung und Dis-kursteilhabe der deutschen Officien zu belegen, wird gezeigt, dass sie nicht nur komplementär zur lateinischen Texttradition breit überliefert, sondern bei aller kulturellen Distanz zu Ciceros paganer Tugendlehre auch darauf ange-legt sind, die Selbstorientierung einer christlichen Leserschaft auf dem Niveau römisch-antiken Klugheitsdenkens anzuleiten. Neben einem Seitenblick auf Ciceros Tuskulanen wird dies anhand ausgewählter Textpassagen aus dem ersten De officiis-Buch sowie am Text-Bild-Programm der 1531 gedruckten Ausgabe Von den tugentsamen ämptern untersucht. Dabei ergibt sich, dass (1.) die Officien in der Volkssprache einen gegenüber dem Lateinischen bis in die Sprachästhetik differenzierten Aneignungsmodus entwickeln, (2.) sie spe-ziell durch die Text-Bild-Modellierung diskursives Eigenprofil gewinnen und (3.) sie in diesem Rahmen kulturell virulente Konzepte wie Menschenwürde und Willensfreiheit adressieren.
Schlagwörter
Antikenübersetzung, Medienwandel, christliche Leseperspektive, Text und Bild, erson und freier Wille